| |

Schatten und Feuer. Auf diesem alpinen Grasland, an der Flanke der Berge, schwingen die Farben zwischen zwei Polen: Dem einen des Schattens mit dem dunklen Grün der Zirbelkiefern, Weißtannen und Eschen, aber noch mehr mit der Palette an matten Tönen der im Schatten liegenden Hänge, der verfluchten Seite jedes Gebirges. Es ist dies sicherlich das wilde Territorium des scheuen Bären, der seine Wege in einer Chlorophyllwelt aus Büschen, düsteren Tannenwäldern, Beerensträuchern, aufgegebenen Autowracks und Höhlen; dies ist die Welt des ersten unter den Jägern mit dicken dunklem Pelz, der sich von der primitiven Schnauze her in saurem Grün und duftendem Braun ausbreitet.
 Auf den sonnigen Hängen dominiert der feurige Pol, wenn es nichts gelingt, die lebendigen Farben der Berge auszufiltern, da weder ein urbanes Szenario, noch ungelegene Rauchschwaden sie in irrer Verachtung vor diesem Hintergrund zurückdrängen können. Nun ist es so, dass die Farbe, wie in den Bildern von Segantini, Funken des Feuers aufnimmt, funkelt, vibriert, ihre Kraft durchsetzt. Sie wird zu einer vielköpfigen Schlange. Ist freie Materie. Im Val Nambrone erhebt sich längs der Granit wie eine beige, graue, smaragdene Hand, bevor er vom Sauerstoff der Gipfel berührt wird und in Himmelblau verdampft; weiter unten erzeugt er dann ein pflanzliches Geflecht, das sich mitunter zwischen zwei Granitfelsen schmuggelt. Unterhalb von Campiglio, wo die gewichtigen Chalets am Ortseingang mit Blumen geschmückt sind, bedecken Tannenwälder die schroffen Steilwände, die zum Wasserfall von Vallesinella leiten. Dort ist das himmlische Blau der Wasserfälle dermaßen schnell, dass es unsichtbar zu sein scheint. Auf den sonnigen Hängen dominiert der feurige Pol, wenn es nichts gelingt, die lebendigen Farben der Berge auszufiltern, da weder ein urbanes Szenario, noch ungelegene Rauchschwaden sie in irrer Verachtung vor diesem Hintergrund zurückdrängen können. Nun ist es so, dass die Farbe, wie in den Bildern von Segantini, Funken des Feuers aufnimmt, funkelt, vibriert, ihre Kraft durchsetzt. Sie wird zu einer vielköpfigen Schlange. Ist freie Materie. Im Val Nambrone erhebt sich längs der Granit wie eine beige, graue, smaragdene Hand, bevor er vom Sauerstoff der Gipfel berührt wird und in Himmelblau verdampft; weiter unten erzeugt er dann ein pflanzliches Geflecht, das sich mitunter zwischen zwei Granitfelsen schmuggelt. Unterhalb von Campiglio, wo die gewichtigen Chalets am Ortseingang mit Blumen geschmückt sind, bedecken Tannenwälder die schroffen Steilwände, die zum Wasserfall von Vallesinella leiten. Dort ist das himmlische Blau der Wasserfälle dermaßen schnell, dass es unsichtbar zu sein scheint.
Val Nambrone. Die Gegensätze von Licht und Schatten wechseln sich ab. Die Farben strömen wie jener Sand, der den Flüssen den Türkis schenkt. Am schattigen Ende bewegen sich violette Blaubeerpünktchen, Beerchen, die zunächst unsichtbar sind, derer man dann jedoch urplötzlich gewahr wird, bis man nichts anderes mehr sieht. Und wiederum ist da dieses Feuer, das Grasland der Matten, auf denen das Rad der Zeit sich dreht, die warmen und hellen Mäuler der Milchkühe aus dem Val Rendena, die zwischen den Disteln bei einer jener Sennereien grasen, die dem ländlichen Adel gehörten. Weiter oben liegt eine Seenkette, die größte und am weitesten entfernte hat eine tiefblaue, mitunter undurchsichtige Färbung. Der kleinste von ihnen hingegen ist ein klarer Tropfen, wie von den Bergen herunter gerollt, der sie unverfälscht und klar umrissen widerspiegelt. Auf dem weißen Rückweg, der die Farbe von Talkum und Gips hat (die Sonne bereitet gerade ihren Rückzug vor), setzen gesprenkelte Kiesel, schwarze Punkte auf dem Weiß, das Farbenspiel im Mikrokosmos fort, bis die Erde ganz unten ihren schwermütigen Schatten wiederfindet und der Himmel preußischblau wird.
In der Ferne vereinigen sich alle am Tag erschienenen Farben zu Füßen der Brenta-Gruppe, steigen dann empor und verbinden sich in der Vertikalen der fugenlosen Wände zu versteinerten Bündeln.
Denn es geschieht etwas dort oben zwischen den Türmen und Stufen, auf den glatten und abgeschabten Seiten, auf den silbrigen Hochebenen. Rosa und frisch am Morgen, färben sich die Dolomiten gen Mittag gelblich, grünen am Nachmittag wieder wie am Ende von den Farbstrahlen überflutet, die von den Kegeln der Fichtenbäume, bis sie am Abend streifenweise die Indigotöne eines lebendigen Rots annehmen. Während des ganzen Tages saugen sie Licht auf wie unterseeische Schwämme und strahlen es dann wieder ab, wie es die Korallen einstmals taten.
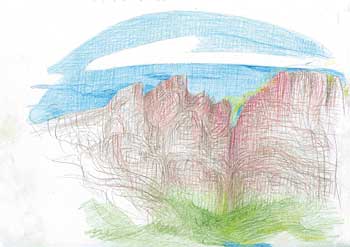 Gibt es so etwas wie eine dolomitische Dunkelheit? Werfen sie Schatten wie andere Gebirge aus Sandstein, aus Schiefer, aus Granit? In diesem Sommer vermutlich nicht, da die bleichen Berge ihre schattigen Massen nicht auf die Natur werfen und sie zur Gefangenen dieser hohen porösen Mauern aus Kalk und Magnesium machen können. Sie bleiben fern wie der Mond, dessen Allgegenwart allzeit diskret getönt ist. Er ist fern, seidig, kalt. Und die Berge sind fern, kalt, seidig. Ihre Form ist klar, perfekt, stets ergreifend. Gibt es so etwas wie eine dolomitische Dunkelheit? Werfen sie Schatten wie andere Gebirge aus Sandstein, aus Schiefer, aus Granit? In diesem Sommer vermutlich nicht, da die bleichen Berge ihre schattigen Massen nicht auf die Natur werfen und sie zur Gefangenen dieser hohen porösen Mauern aus Kalk und Magnesium machen können. Sie bleiben fern wie der Mond, dessen Allgegenwart allzeit diskret getönt ist. Er ist fern, seidig, kalt. Und die Berge sind fern, kalt, seidig. Ihre Form ist klar, perfekt, stets ergreifend.
In der Rückschau erinnere ich mich an die Berge der Hochalpen oder der Isère in Frankreich, an melancholische Winter. Der Schatten der Berge ist schwer, unbarmherzig, in ihnen mischen sich Stein und träger Fels; das ist die Stunde, in der das Gebirge in seinem bedrückenden Schatten passiv das zermalmt, was es bis dahin passiv dominiert hatte.
Aber es ist Sommer, und die Dolomiten strahlen nachts im Mondlicht weiter, wechseln dabei wie eine morgendliche Tide, zurückgebracht aus dem Osten, der sie erhellt. Ich erblicke durchsichtige, durchscheinende Berge; während ich auf der Serpentinenstraße von Madonna di Campiglio nach Pinzolo wandere, sehe in regelmäßigen Abständen, wenngleich nur flüchtig, ihr zuckendes Fleisch, das keinen Schatten erzeugen kann.
Der Facteur Cheval und die Dolomiten
Was sehe ich, habe ich gesehen, bei der Betrachtung der Dolomiten? Spitzen, Nadeln, Zinnen, Türme, Stützbögen, Spitzbögen; dann Glockentürme, Kuppeln, weitere Türme, aber auch Korallen, Schwämme und Muscheln, tausend vermischte und abgelagerte Dinge, die man auch an den Seiten des von Ferdinand Cheval in Hauterives erbauten, so genannten Palais idéal entdecken könnte. In der Rückschau denke ich an den idealen Palast und seinen, ungelernten, Baumeister Cheval, einen heldenhaften Künstler, der in den Hügeln der Drôme in Frankreich sein Leben damit verbrachte, Stein um Stein seinen Tempel der Natur (in der Folge als Palais idéale bezeichnet) zu bauen. Zweifelsohne hat sein Leben an den Ausläufern der Alpen unseren Helden inspiriert, was auch erklärt, warum sein Palast wie die Tempel von Angkor Wat oder die Hindutempel in Indien ein geologisch-archäologisches Sammelsurium darstellen. Die Pflanze stellt sich Seite an Seite zum Mineral; die Sedimentation der Stile macht es quasi zu einem Oeuvre der Natur, arglos und heilig zugleich. Gleiches gilt für die Dolomiten, die, hätten sie sehen können, die anfängliche Intuition des Erbauers bestätigt hätten, der über einen wunderbaren Kiesel von den Bergpfaden der Drôme sprach, wohl wissend, dass im Zauber einer mineralischen Form niemals etwas Erzwungenes liegt, und dass sie nur die Erinnerung an vorsintflutliche, ganz notwendigerweise „geniale“ Epochen in sich tragen.
Und dass sie Teil des erstarrten Unbewussten sind, hätten die Pariser Surrealisten hinzugefügt, die große Bewunderer des Erbauers waren.
 Die Festung Bastiani und der Walzer Die Festung Bastiani und der Walzer
Am Abend, im Mondlicht, sehe ich in den Dolomiten eine imaginäre Festung zwischen zwei Welten, die Festung Bastiani aus der „Tartarenwüste“ von Dino Buzzati. Ich stelle mir die Horden Zimbern, Langobarden und Bajuwaren vor, die alle die bleichen Berge vor sich haben aufrichten gesehen, beschienen vom Licht aus dem Osten, bevor es sich in das Bauwerk ergoss, welches die maritime Szenerie von Genua, Venedig oder Ravenna vor ihnen verbarg; der Großteil von ihnen zog durch das Val Rendena zu Füßen des Brenta-Massivs weiter. Sie erstrahlten in einem letzten Rest des Mondes vor der prallen Sonne. Es waren die Tartaren, deren letzte Reinkarnationen sicherlich die österreichisch-ungarischen Soldaten von 1915 darstellten, die gekommen waren, um einen fahlen, mondlichtbleichen Krieg in die Ödnisse der Gipfel zu tragen.
In einer Stub‘ in Campiglio, nach Einbruch der Nacht, in der Nähe der indigofarbenen Dolomiten scheint es mir, ein österreichisch-ungarischer Italiener zu sein; ich beginne, unter Zuhilfenahme eines österreichischen Bieres, abzuschweifen: "Die Festung war Teil des Ostreichs, und die bleichen Berge verbanden die italienische Halbinsel mit dem so genannten Binnenmeer, das sich von Lothringen bis in die Vojvodina und nach Galizien erstreckte und eine Zeitlang von den Habsburgern aus Wien beherrscht wurde. Eines der politischen und militärischen Herzstücke Europas lag nun im Gebirge, und das Trentino gehörte dazu wie die Sudeten oder Transilvanien. Mit den Bergen der tschechischen und slowakischen Länder, die italienischen Alpen, die Karpaten, hat das Habsburger Reich nach und nach jene Tentakel verloren, die es ihm erlaubten, sich von Wien aus in ganz Europa zu verzweigen. Das Imperium hatte mit Sissi seine letzte Mondkönigin, wonach es sich in einem Walzerlied auflöste, einem Radetzky-Marsch, den man immer noch im habsburgischen Karneval Ende Juli in Madonna di Campiglio hören kann.“
Geblieben ist etwas von den Wiener Tänzen, von Harmonie, von Prunk und Stabilität durchwoben im Spektakel der Dolomiten der Brenta und in Madonna di Campiglio.
Und etwas von den Dolomiten ist zweifellos in den metaphysischen und lunaren Erzählungen von Buzzati, wie im Konzept der Festung Bastiani.
Sennereien
Das Val di Genova. Der Grund des Alpentals gibt die Atmosphäre einer biblischen Wüste wieder. Die Beklemmung, sich hier zu befinden, wird durch eine Art Rausch ausgeglichen, der eintritt, wenn der Klang der Kuhglocken die Stille noch tiefer werden lässt. Einsamkeit, Ärmlichkeit, Sonne: ein rares Gemengsel. Im Mittelalter mussten die Besitzer der wertvollen Sennen unbarmherzig zu einander sein, so wie die Hirten im Alten Testament, die immer den eigenen Stamm und die eigene Herde hinter sich hatten. Zweifelsohne sind diese Täler noch in unseren Tagen Heimat solch alter Hirten, die darin die Erinnerung weitertragen, und in ihrer relativen Einsamkeit als Propheten wirken.
 Die Macht einer Postkarte Die Macht einer Postkarte
Eine Postkarte hat noch etwas Physisches, aber auch etwas Magisches.
Ich habe einem Freund eine Ansicht der Dolomiten geschickt, und ihn dann aus reiner Neugier gebeten, mir zu sagen, was er gesehen hätte. Er antwortete, er hätte eine verschwundene Welt gesehen, die immer noch nicht wahrnehmbare Zeichen sendete, die er mit den Dolomiten und ihren Geheimnissen verbunden hätte, zumal die Karte von „dort unten“ abgeschickt worden wäre. Ganz so als ob die bleichen Berge etwas von ihrer Macht auf die Postkarte übertragen hätten und auch heute noch, aus dem Kästchen heraus, von einer Krage herab, vielleicht auch im Licht eines Hauses in Gard, weit entfernt von städtischen Szenerien, ihre Wirkung zeigten.
|
|

 Auf den sonnigen Hängen dominiert der feurige Pol, wenn es nichts gelingt, die lebendigen Farben der Berge auszufiltern, da weder ein urbanes Szenario, noch ungelegene Rauchschwaden sie in irrer Verachtung vor diesem Hintergrund zurückdrängen können. Nun ist es so, dass die Farbe, wie in den Bildern von Segantini, Funken des Feuers aufnimmt, funkelt, vibriert, ihre Kraft durchsetzt. Sie wird zu einer vielköpfigen Schlange. Ist freie Materie. Im Val Nambrone erhebt sich längs der Granit wie eine beige, graue, smaragdene Hand, bevor er vom Sauerstoff der Gipfel berührt wird und in Himmelblau verdampft; weiter unten erzeugt er dann ein pflanzliches Geflecht, das sich mitunter zwischen zwei Granitfelsen schmuggelt. Unterhalb von Campiglio, wo die gewichtigen Chalets am Ortseingang mit Blumen geschmückt sind, bedecken Tannenwälder die schroffen Steilwände, die zum Wasserfall von Vallesinella leiten. Dort ist das himmlische Blau der Wasserfälle dermaßen schnell, dass es unsichtbar zu sein scheint.
Auf den sonnigen Hängen dominiert der feurige Pol, wenn es nichts gelingt, die lebendigen Farben der Berge auszufiltern, da weder ein urbanes Szenario, noch ungelegene Rauchschwaden sie in irrer Verachtung vor diesem Hintergrund zurückdrängen können. Nun ist es so, dass die Farbe, wie in den Bildern von Segantini, Funken des Feuers aufnimmt, funkelt, vibriert, ihre Kraft durchsetzt. Sie wird zu einer vielköpfigen Schlange. Ist freie Materie. Im Val Nambrone erhebt sich längs der Granit wie eine beige, graue, smaragdene Hand, bevor er vom Sauerstoff der Gipfel berührt wird und in Himmelblau verdampft; weiter unten erzeugt er dann ein pflanzliches Geflecht, das sich mitunter zwischen zwei Granitfelsen schmuggelt. Unterhalb von Campiglio, wo die gewichtigen Chalets am Ortseingang mit Blumen geschmückt sind, bedecken Tannenwälder die schroffen Steilwände, die zum Wasserfall von Vallesinella leiten. Dort ist das himmlische Blau der Wasserfälle dermaßen schnell, dass es unsichtbar zu sein scheint.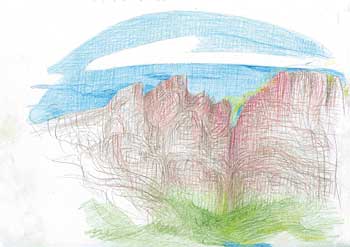 Gibt es so etwas wie eine dolomitische Dunkelheit? Werfen sie Schatten wie andere Gebirge aus Sandstein, aus Schiefer, aus Granit? In diesem Sommer vermutlich nicht, da die bleichen Berge ihre schattigen Massen nicht auf die Natur werfen und sie zur Gefangenen dieser hohen porösen Mauern aus Kalk und Magnesium machen können. Sie bleiben fern wie der Mond, dessen Allgegenwart allzeit diskret getönt ist. Er ist fern, seidig, kalt. Und die Berge sind fern, kalt, seidig. Ihre Form ist klar, perfekt, stets ergreifend.
Gibt es so etwas wie eine dolomitische Dunkelheit? Werfen sie Schatten wie andere Gebirge aus Sandstein, aus Schiefer, aus Granit? In diesem Sommer vermutlich nicht, da die bleichen Berge ihre schattigen Massen nicht auf die Natur werfen und sie zur Gefangenen dieser hohen porösen Mauern aus Kalk und Magnesium machen können. Sie bleiben fern wie der Mond, dessen Allgegenwart allzeit diskret getönt ist. Er ist fern, seidig, kalt. Und die Berge sind fern, kalt, seidig. Ihre Form ist klar, perfekt, stets ergreifend. Die Festung Bastiani und der Walzer
Die Festung Bastiani und der Walzer Die Macht einer Postkarte
Die Macht einer Postkarte